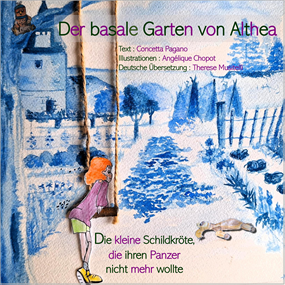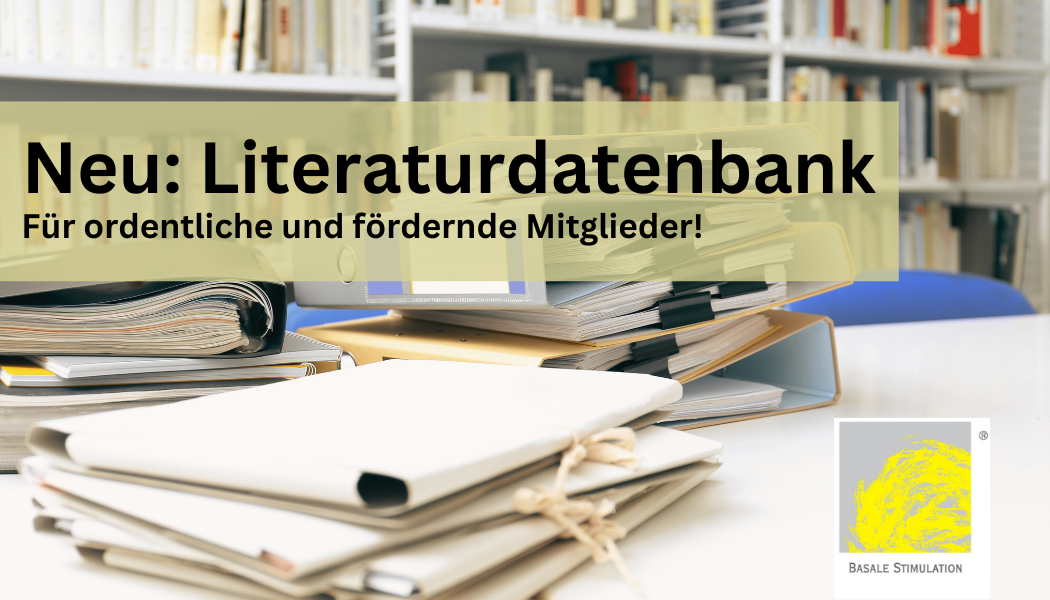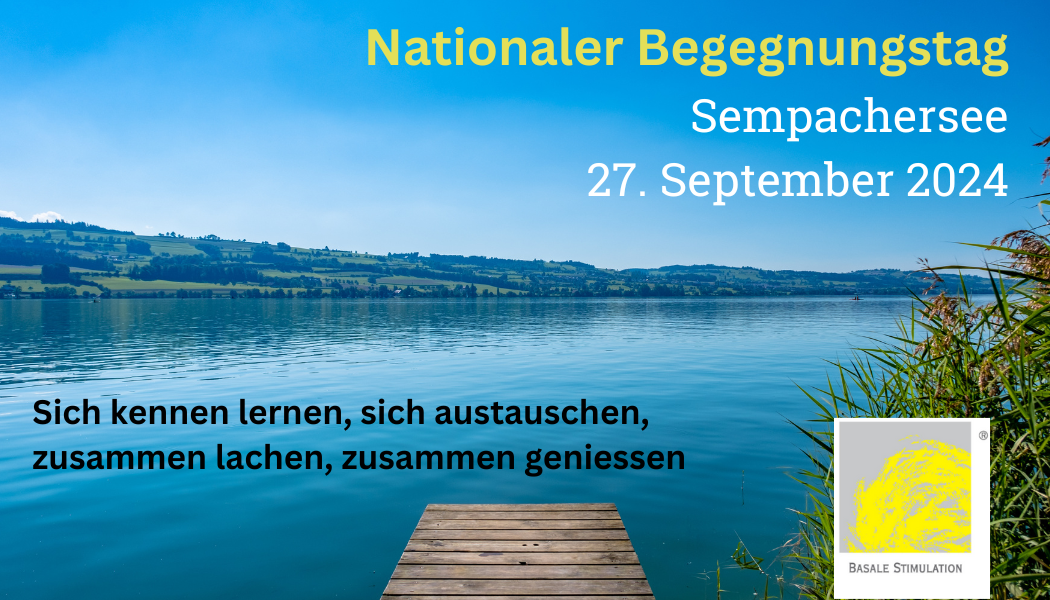INTERNATIONALER FÖRDERVEREIN
Basale Stimulation
Unser Verein widmet sich der Bildungsarbeit, Forschung und Weiterentwicklung im Konzept Basale Stimulation. Wir qualifizieren Pflegende, Pädagogen, Therapeuten, Betreuende und Angehörige im Konzept der Basalen Stimulation.
INTERNATIONALER FÖRDERVEREIN
Basale Stimulation e.V.
Unser Verein widmet sich der Bildungsarbeit, Forschung und Weiterentwicklung im Konzept Basale Stimulation. Wir qualifizieren Pflegende, Pädagogen, Therapeuten, Betreuende und Angehörige im Konzept der Basalen Stimulation.
Aktuelles
hier finden Sie unsere Aktuellen Neuigkeiten & Informationen rund um das Thema Basale Stimulation.
Fachpersonen in Europa
Klicken Sie auf die Flagge um zu den Fachpersonen zu gelangen.

Bildungsangebote
Das Unterrichten des Konzeptes unterliegt der Lizenzpflicht. Unsere lizenzierten Fachpersonen weisen sich durch diese Teilnahmebescheinigung und ihren persönlichen Lizenzstempel aus.

Was ist Basale Stimulation?
Das Konzept wurde in den 1970-ger Jahren von dem Sonderpädagogen Andreas Fröhlich als Förderangebot für Kinder mit schwerer Behinderung entwickelt. In die Konzeptentwicklung einbezogen wurden Neuro- und verhaltensbiologische Erkenntnisse (Pechstein, J. 1975) sowie entwicklungspsychologische und -physiologischen Erkenntnisse (Jetter,K. Piaget, J. 1975, B. und K. Bobath 1977).
Der Impuls Basale Stimulation auch in die Pflege erwachsener Menschen zu übertragen erfolgte durch die Krankenschwester, Diplompädagogin und spätere Pflegewissenschaftlerin Christel Bienstein in den 1980er-Jahren. Gemeinsam mit Andreas Fröhlich wurden die Erfahrungen analysiert, systematisiert und auch wissenschaftlich begleitet.
Heute ermöglicht Basale Stimulation eine individuell therapeutische, sowie rehabilitativ fördernde Pflege und Begleitung von Menschen jeden Lebensalters nach wissenschaftlich anerkannten Kriterien.
Die Begriffe „Basal“ und „Stimulation“ weisen auf elementare körperbasierte Anregungen hin. Im Zentrum des Konzepts steht die menschliche Begegnung in Form eines von Achtsamkeit geprägten Dialogs.
Vergl.: Münstermann U. Pflege gestalten im Hier und Jetzt; JuKiP 2022; 11: 96–103 | © 2022. Thieme.

Der Verein
Seit seiner Gründung im Jahr 2001 auf Initiative durch den Begründer des Konzeptes Andreas Fröhlich widmet sich der Verein leidenschaftlich der Bildungsarbeit, Forschung und kontinuierlichen Weiterentwicklung dieses wegweisenden Konzeptes.
Treten Sie unserem internationalen Netzwerk bei, welches sich aus herausragenden Fachpersonen der Basalen Stimulation zusammensetzt. Durch Ihre Unterstützung wird unsere wichtige Arbeit für eine mitmenschliche und förderliche Begleitung pflege- und hilfebedürftiger Menschen erst möglich. Werden Sie Mitglied oder qualifizieren Sie sich selbst im Konzept. Gestalten Sie gemeinsam mit uns eine Welt, in der jeder Mensch die Chance auf die Pflege und Begleitung hat, die er benötigt und verdient.
Der Internationale Förderverein Basale Stimulation® e.V.- gemeinsam für ein würdevolles Leben trotz Pflegebedürftigkeit!